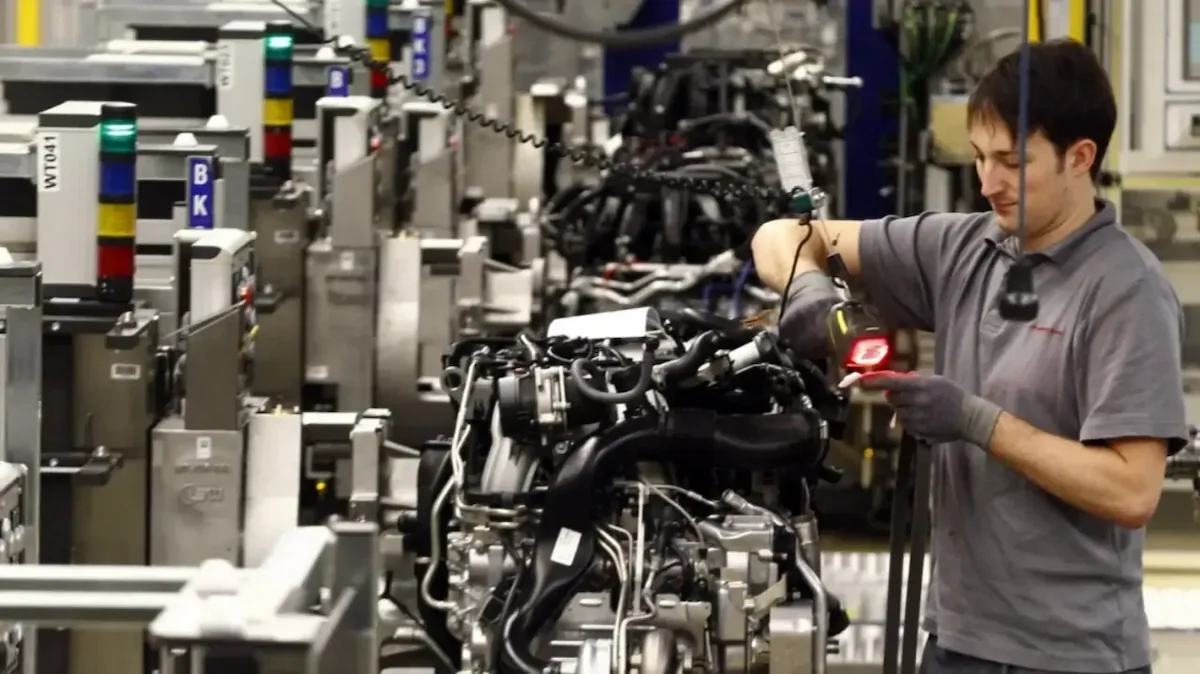Der Fachkräftemangel entwickelt sich in Europa zunehmend zur wirtschaftlichen Bremse – allen voran in Deutschland. Die absehbare Pensionierung der Babyboomer-Generation verschärft die Situation zusätzlich. Besonders kleine und mittlere Unternehmen schlagen Alarm: Zwei Drittel von ihnen können kaum noch qualifiziertes Personal finden. Das Problem ist jedoch nicht nur ein deutsches, sondern betrifft die gesamte Europäische Union.
Angesichts der angespannten Lage öffnen sich die EU-Staaten zögerlich für Fachkräfte aus Drittstaaten. Ein zentrales Instrument zur Steuerung ist die sogenannte Blue Card, ein spezieller Aufenthaltstitel für hochqualifizierte Nicht-EU-Bürger mit akademischem Abschluss. Neben dem Studienabschluss ist auch ein bestimmtes Mindesteinkommen im angestrebten Job Voraussetzung.
In Deutschland liegt diese Gehaltsschwelle ab dem Jahr 2025 bei 48.300 Euro brutto jährlich. Für sogenannte Mangelberufe – etwa in den Bereichen Medizin, Pädagogik oder MINT – genügt ein geringeres Einkommen von 43.759,80 Euro. Hier ist jedoch zusätzlich eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit erforderlich.
EU-weiter Vergleich zeigt große Unterschiede
Eine Analyse der GISMA Business School verdeutlicht: Deutschland bewegt sich mit seinen Anforderungen im europäischen Mittelfeld. Die höchsten Gehaltsanforderungen für Blue-Card-Bewerber stellt Belgien. Dort sind es bis zu 66.377 Euro im Jahr. Auch in Frankreich (59.700 Euro), Luxemburg (58.968 Euro) und Schweden (51.997 Euro) liegen die Schwellenwerte deutlich höher als in Deutschland.
Andere Länder setzen bewusst niedrigere Hürden. So hat Bulgarien die Gehaltsgrenze drastisch gesenkt – von über 21.000 Euro auf knapp 9.933 Euro. In Rumänien liegt sie bei rund 20.700 Euro und in Portugal bei 21.030 Euro. Bemerkenswert ist, dass Portugal die Anforderungen im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent erhöht hat – der stärkste Anstieg unter den analysierten Ländern.
Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Migrationspolitik
Die Schwankungen innerhalb Europas sind laut Gisma-Präsident Ramon O’Callaghan Ausdruck unterschiedlicher wirtschaftlicher Realitäten und politischer Strategien. Einige Länder setzen gezielt auf niedrigere Einstiegshürden, um für Fachkräfte attraktiver zu werden. Andere streben mit höheren Anforderungen ein bestimmtes Qualifikationsniveau an.
O’Callaghan warnt jedoch vor möglichen Folgen für Deutschland: „Die Herausforderung besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen Attraktivität für internationale Talente und den Bedürfnissen des heimischen Arbeitsmarktes zu schaffen.“ Deutschland dürfe im internationalen Wettbewerb um Fachkräfte nicht ins Hintertreffen geraten. Weitere Reformen seien notwendig, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben und den eigenen Bedarf zu decken.